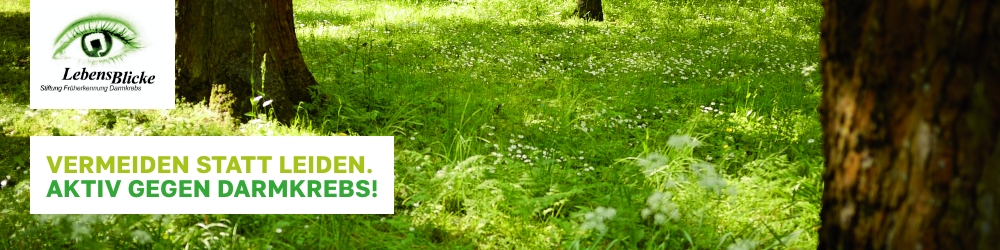Auf dem Kongress Viszeralmedizin 2013 in Nürnberg hat die Stiftung LebensBlicke zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) ein Symposium zum Thema „Qualitätsanforderungen in der Darmkrebs-Prävention“ veranstaltet. Es wurde von Prof. Dr. M. Ebert, Direktor der II. Med. Universitätsklinik Mannheim und Vorstandsmitglied der SLB (re.), und Prof. Dr. J. F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der SLB (li.) moderiert. Die Vorsorgekoloskopie gehört seit 2002 neben dem Test auf okkultes Blut im Stuhl zum Vorsorge- und Früherkennungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherungen. Eine entscheidende Voraussetzung für die Einführung der invasiven Technik waren Qualitätsstandards, die eingehalten und überprüft werden müssen. Das Symposium hatte sich zur Aufgabe gestellt, die Eckpfeiler und wichtigsten Aussagen der Qualitätsanforderungen zusammenzufassen und auf ihre Wertigkeit hin zu überprüfen.
Auf dem Kongress Viszeralmedizin 2013 in Nürnberg hat die Stiftung LebensBlicke zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) ein Symposium zum Thema „Qualitätsanforderungen in der Darmkrebs-Prävention“ veranstaltet. Es wurde von Prof. Dr. M. Ebert, Direktor der II. Med. Universitätsklinik Mannheim und Vorstandsmitglied der SLB (re.), und Prof. Dr. J. F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der SLB (li.) moderiert. Die Vorsorgekoloskopie gehört seit 2002 neben dem Test auf okkultes Blut im Stuhl zum Vorsorge- und Früherkennungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherungen. Eine entscheidende Voraussetzung für die Einführung der invasiven Technik waren Qualitätsstandards, die eingehalten und überprüft werden müssen. Das Symposium hatte sich zur Aufgabe gestellt, die Eckpfeiler und wichtigsten Aussagen der Qualitätsanforderungen zusammenzufassen und auf ihre Wertigkeit hin zu überprüfen.
 Dr. Bernd Birkner (München) referierte initial zum Stand der Information und der Einladungspraxis vor dem Hintergrund des vom Gesetzgeber im April 2013 beschlossenen Krebsfrüherkennungs-Registergesetzes (KFRG). Schlüsselfaktoren sind die Notwendigkeit der informierten Entscheidung für Patient und Arzt, Kenntnis von und Verständnis für die bestverfügbare Evidenz sowie eine Entscheidungsfindung auf dem Boden der ärztlichen Beratung und der Präventionspräferenzen der Anspruchsberechtigten. Dem stehen natürlich auch Hemmschwellen gegenüber wie Zeit, das Patientenprofil, die klinische Situation (ob Diagnostik, Therapie oder Screening) sowie die Vergütung. Vor dem Hintergrund des KFRG sind auch weitere Implementierungen notwendig wie ein Training von Ärzten und medizinischem Fachpersonal, das Verständnis des Patienten für das Gesundheitssystem, einheitliches Informationsmaterial sowie Entscheidungshilfen, die Kosten und natürlich auch die Evaluierung der eingeführten Maßnahmen. Bisherige Ergebnisse weisen aus, dass eine generelle Information nur bedingt Niederschlag bei den Anspruchsberechtigten findet; daraus muss man schlussfolgern, dass nur eine personalisierte, also zielgruppenspezifische Information einen Verbesserungseffekt aufzeigt.
Dr. Bernd Birkner (München) referierte initial zum Stand der Information und der Einladungspraxis vor dem Hintergrund des vom Gesetzgeber im April 2013 beschlossenen Krebsfrüherkennungs-Registergesetzes (KFRG). Schlüsselfaktoren sind die Notwendigkeit der informierten Entscheidung für Patient und Arzt, Kenntnis von und Verständnis für die bestverfügbare Evidenz sowie eine Entscheidungsfindung auf dem Boden der ärztlichen Beratung und der Präventionspräferenzen der Anspruchsberechtigten. Dem stehen natürlich auch Hemmschwellen gegenüber wie Zeit, das Patientenprofil, die klinische Situation (ob Diagnostik, Therapie oder Screening) sowie die Vergütung. Vor dem Hintergrund des KFRG sind auch weitere Implementierungen notwendig wie ein Training von Ärzten und medizinischem Fachpersonal, das Verständnis des Patienten für das Gesundheitssystem, einheitliches Informationsmaterial sowie Entscheidungshilfen, die Kosten und natürlich auch die Evaluierung der eingeführten Maßnahmen. Bisherige Ergebnisse weisen aus, dass eine generelle Information nur bedingt Niederschlag bei den Anspruchsberechtigten findet; daraus muss man schlussfolgern, dass nur eine personalisierte, also zielgruppenspezifische Information einen Verbesserungseffekt aufzeigt.
 Privatdozentin Dr. Andrea Riphaus (Laatzen) berichtete über die Aufklärung in der Endoskopie. Wichtigkeit und Notwendigkeit resultierten aus der rechtlichen Einordnung des ärztlichen Heileingriffes als Körperverletzung, zu der der Betroffene sein Einverständnis geben muss. Deshalb gilt als Orientierungshilfe im Rahmen der Aufklärung die Checkliste der 6 „Ws“ (Wer? Wen? Wann? Wie? Worüber? Wieweit?). Dieser Fragenkatalog setzt voraus, dass die Aufklärung durch den behandelnden Arzt respektive einen anderen Arzt erfolgen muss; die Delegation an Assistenzpersonal ist nicht zulässig. Da der Patient der Untersuchung zustimmen muss, ist eine ausführliche Dokumentation zwingend. Von einem Aufklärungsverzicht ist abzuraten, es sei denn, der Patient wünscht dies ausdrücklich und unterschreibt es. Es versteht sich, dass der Patient beim Informationsgespräch aufnahmefähig und einwilligungsfähig sein muss. Er muss rechtzeitig, dass heißt ohne Zeitdruck seine Entscheidung treffen können. Das bedeutet in der Regel, dass der Patient ggf. auch eine Nacht darüber schlafen können muss, von Notfalleingriffen natürlich abgesehen. Der Umfang der Aufklärung ist abhängig von der Indikation, der Häufigkeit und Schwere, möglichen vor allem häufigen Risiken, von der Angabe von Behandlungsalternativen und von der Nennung schwerster Risiken auch dann, wenn sie sehr selten sind. Auch hier gilt im individuellen Fall natürlich das Augenmaß.
Privatdozentin Dr. Andrea Riphaus (Laatzen) berichtete über die Aufklärung in der Endoskopie. Wichtigkeit und Notwendigkeit resultierten aus der rechtlichen Einordnung des ärztlichen Heileingriffes als Körperverletzung, zu der der Betroffene sein Einverständnis geben muss. Deshalb gilt als Orientierungshilfe im Rahmen der Aufklärung die Checkliste der 6 „Ws“ (Wer? Wen? Wann? Wie? Worüber? Wieweit?). Dieser Fragenkatalog setzt voraus, dass die Aufklärung durch den behandelnden Arzt respektive einen anderen Arzt erfolgen muss; die Delegation an Assistenzpersonal ist nicht zulässig. Da der Patient der Untersuchung zustimmen muss, ist eine ausführliche Dokumentation zwingend. Von einem Aufklärungsverzicht ist abzuraten, es sei denn, der Patient wünscht dies ausdrücklich und unterschreibt es. Es versteht sich, dass der Patient beim Informationsgespräch aufnahmefähig und einwilligungsfähig sein muss. Er muss rechtzeitig, dass heißt ohne Zeitdruck seine Entscheidung treffen können. Das bedeutet in der Regel, dass der Patient ggf. auch eine Nacht darüber schlafen können muss, von Notfalleingriffen natürlich abgesehen. Der Umfang der Aufklärung ist abhängig von der Indikation, der Häufigkeit und Schwere, möglichen vor allem häufigen Risiken, von der Angabe von Behandlungsalternativen und von der Nennung schwerster Risiken auch dann, wenn sie sehr selten sind. Auch hier gilt im individuellen Fall natürlich das Augenmaß.
 Privatdozent Dr. Siegbert Faiss (Hamburg) referierte zur Qualität in der Endoskopie. Er berichtete über die schon seit Jahren geltenden Qualitätsanforderungen für Kollegen, die Vorsorgekoloskopien durchführen. Dazu gehören Koloskopieerfahrung (über 200 Koloskopien pro Jahr und mehr als 10 Polypektomien pro Jahr), die Zökum-Intubationsrate (>95%), die Fotodokumentation des Zökums/terminalen Ileums, die Komplikationserfassung (<1%) sowie klare Hygieneanforderungen. Dass diese Maßnahmen wirksam sind, zeigen die 10-Jahreserhebungen des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, die den Untersuchern eine äußerst niedrige Komplikationsrate attestieren (Altenhofen et al. 2013). Neuere Qualitätsanforderungen sind die möglichst hohe Adenom-Detektionsrate (>>20%) sowie die Zahl der Intervallkarzinome. Dazu gehören auch die Geräte-Rückzugszeit, die nicht kürzer als 6 Minuten sein sollte, eine möglichst hohe Rate vollständiger Polypektomie sowie die Erfassung der 30-Tage Komplikationsrate.
Privatdozent Dr. Siegbert Faiss (Hamburg) referierte zur Qualität in der Endoskopie. Er berichtete über die schon seit Jahren geltenden Qualitätsanforderungen für Kollegen, die Vorsorgekoloskopien durchführen. Dazu gehören Koloskopieerfahrung (über 200 Koloskopien pro Jahr und mehr als 10 Polypektomien pro Jahr), die Zökum-Intubationsrate (>95%), die Fotodokumentation des Zökums/terminalen Ileums, die Komplikationserfassung (<1%) sowie klare Hygieneanforderungen. Dass diese Maßnahmen wirksam sind, zeigen die 10-Jahreserhebungen des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung, die den Untersuchern eine äußerst niedrige Komplikationsrate attestieren (Altenhofen et al. 2013). Neuere Qualitätsanforderungen sind die möglichst hohe Adenom-Detektionsrate (>>20%) sowie die Zahl der Intervallkarzinome. Dazu gehören auch die Geräte-Rückzugszeit, die nicht kürzer als 6 Minuten sein sollte, eine möglichst hohe Rate vollständiger Polypektomie sowie die Erfassung der 30-Tage Komplikationsrate.
 Dr. Sebastian Belle (Mannheim) brachte die Kontrollen nach vorausgegangener Vorsorgekoloskopie auf den Punkt. Generell gilt, dass die Kontrolluntersuchung vom individuellen Risiko und vom Erstbefund abhängig ist. Das Risiko ist bestimmt zum einen von der Adenomrezidivrate und zum anderen von der kompletten Abtragung initialer Adenome. Daher ist die initiale Untersuchung der Schlüssel für das weitere Vorgehen, das letztlich auch von den S3-Leitlinien für das kolorektale Karzinom festgelegt wird (Pox et al. Z Gastroenterol 2013;51:753-854). Belle stellte 3 Gruppen vor: Patienten, die kein erhöhtes Risiko haben, solche, die ein niedriges und solche, die ein hohes Risiko haben. Zu Gruppe 1 gehören Menschen, bei denen die Erstuntersuchung keinen Befund ergeben hat und somit eine Kontrolle erst nach 10 Jahren erforderlich macht. Gruppen mit niedrigem Risiko sind solche, bei denen die Adenome kleiner als 1 cm sind. Es sollten weniger als 3 Adenome sein, und sie sollten keine höhergradigen strukturellen Veränderungen hin zu villösen Elementen oder intraepithelialen Neoplasien haben. Bei dieser Gruppe ist eine Kontrolluntersuchung nach 5 Jahren anzuraten, vorausgesetzt die Abtragung ist komplett erfolgt. Bei hohem Risiko, also mehr als 3 Polypen oder eindeutigen Neoplasien ist eine Kontrolle schon nach 3 Jahren, im Einzelfall sogar früher anzuraten. Ausnahmen sind solche Patienten, bei denen ein großer flacher Polyp in Teilen abgetragen wurde; hier sollte spätestens nach 6 Monaten erneut kontrolliert werden. Darüber hinaus sind besondere Gruppen Menschen mit genetischen Erkrankungen wie der Familiären Adenomatose Coli (FAP) sowie des Lynch-Syndroms. Hier gelten auch gesonderte Anforderungen, die in den S3-Leitlinien präzise skizziert worden sind.
Dr. Sebastian Belle (Mannheim) brachte die Kontrollen nach vorausgegangener Vorsorgekoloskopie auf den Punkt. Generell gilt, dass die Kontrolluntersuchung vom individuellen Risiko und vom Erstbefund abhängig ist. Das Risiko ist bestimmt zum einen von der Adenomrezidivrate und zum anderen von der kompletten Abtragung initialer Adenome. Daher ist die initiale Untersuchung der Schlüssel für das weitere Vorgehen, das letztlich auch von den S3-Leitlinien für das kolorektale Karzinom festgelegt wird (Pox et al. Z Gastroenterol 2013;51:753-854). Belle stellte 3 Gruppen vor: Patienten, die kein erhöhtes Risiko haben, solche, die ein niedriges und solche, die ein hohes Risiko haben. Zu Gruppe 1 gehören Menschen, bei denen die Erstuntersuchung keinen Befund ergeben hat und somit eine Kontrolle erst nach 10 Jahren erforderlich macht. Gruppen mit niedrigem Risiko sind solche, bei denen die Adenome kleiner als 1 cm sind. Es sollten weniger als 3 Adenome sein, und sie sollten keine höhergradigen strukturellen Veränderungen hin zu villösen Elementen oder intraepithelialen Neoplasien haben. Bei dieser Gruppe ist eine Kontrolluntersuchung nach 5 Jahren anzuraten, vorausgesetzt die Abtragung ist komplett erfolgt. Bei hohem Risiko, also mehr als 3 Polypen oder eindeutigen Neoplasien ist eine Kontrolle schon nach 3 Jahren, im Einzelfall sogar früher anzuraten. Ausnahmen sind solche Patienten, bei denen ein großer flacher Polyp in Teilen abgetragen wurde; hier sollte spätestens nach 6 Monaten erneut kontrolliert werden. Darüber hinaus sind besondere Gruppen Menschen mit genetischen Erkrankungen wie der Familiären Adenomatose Coli (FAP) sowie des Lynch-Syndroms. Hier gelten auch gesonderte Anforderungen, die in den S3-Leitlinien präzise skizziert worden sind.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass dieses hervorragend besuchte Symposium in sehr präziser und klarer Art den gegenwärtigen Stand der Qualitätsanforderungen zusammengefasst hat. Es hat gezeigt, dass wir in Deutschland auf einem hohen Niveau sind. Das spiegeln auch die exzellenten Ergebnisse wieder, die jüngst in der „gastroenterologischen Bibel“ publiziert worden sind (Pox et al. Gastroenterology 2012;142:1460-1467).
Prof. Dr. J. F. Riemann
Ludwigshafen, im November 2013