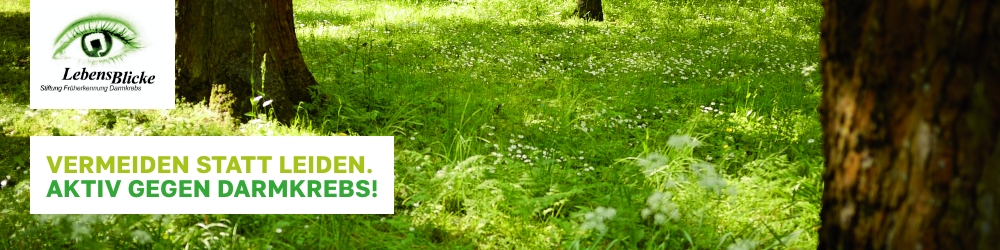„Einmal ist keinmal“, sagt der Volksmund. Bei der Darmkrebstherapie möchte man das eigentlich nicht. Eine internationale prospektive Studie zeigte dazu wichtige Ergebnisse: (Polychronidis G et al.)
„Einmal ist keinmal“, sagt der Volksmund. Bei der Darmkrebstherapie möchte man das eigentlich nicht. Eine internationale prospektive Studie zeigte dazu wichtige Ergebnisse: (Polychronidis G et al.)
Wissenschaftler untersuchten zwei Gruppen: eine Gruppe hatte Polypen mit hohem Risiko, definiert als ≥ 10mm oder ≥ 3 Adenome. In einer 2. Gruppe wurden alle anderen Polypen mit geringerem Risiko eingestuft. Insgesamt konnten 156.699 Patienten untersucht werden, die sich zwischen 2007 und 2017 einer Koloskopie unterzogen hatten. Ein deutlich erhöhtes Risiko für kolorektale Karzinome fand sich bei Personen, bei denen Krebsvorstufen mit hohem Risiko (fortgeschrittene Adenome und bestimmte serratierte Polypen) entfernt worden waren. Und das innerhalb der ersten drei Jahre nach der Polypenentfernung. Anders das Ergebnis bei Patienten mit niedrigem Risiko. Bei ihnen fand sich über einen 10-Jahres-Zeitraum ein nur leicht erhöhtes Darmkrebsrisiko. Die Rezidiv-Läsionen tauchten häufig im gleichen Darmsegment auf wie bei der Indexkoloskopie. Das darauf hindeutet, dass es sich u.U. um eine unvollständige Resektion oder um übersehene Läsionen handelte. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse unterstützen die Empfehlungen für eine erneute Koloskopie innerhalb von drei bis fünf Jahren bei Personen mit Hochrisiko-Polypen und einem deutlich längeren Intervall bei Personen mit Niedrigrisiko. Außerdem unterstreichen sie die grundsätzliche Notwendigkeit einer verbesserten Koloskopie-Überwachung, um die Inzidenz von Intervallkarzinomen zu verringern. Diese wissenschaftliche Forderung steht ganz im Einklang mit den Zielen der Stiftung Lebensblicke unter ihrem Vorsitzenden Prof. Dr. J.F. Riemann: Vermeiden statt leiden!. Dr. H. Meyer – Stiftung Lebensblicke; Quelle: Ärztezeitung online 11.9.2024
Archiv des Autors: admin_LebensBlicke
Aktueller Beitrag in der Focus online Expert-Reihe
 Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen des Menschen. Er ist heimtückisch und bleibt oft lange unbemerkt. Der Focus veröffentlichte einen aktuellen Beitrag der Focus online Expert-Reihe „Vermehrt auch bei Jüngeren – Nehmen Sie diese Darmkrebs-Alarmzeichen ernst“ auf seinen online-Plattformen. Prof. Dr. J.F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke, berichtet in diesem Artikel über die zunehmende Zahl an Erkrankungen bei jüngeren Patienten, was man dagegen tun kann, und klärt über wichtige Symptome, Prävention und die Notwendigkeit der Vorsorge auf, gemäß dem Motto der Stiftung „Vermeiden statt leiden!“.
Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen des Menschen. Er ist heimtückisch und bleibt oft lange unbemerkt. Der Focus veröffentlichte einen aktuellen Beitrag der Focus online Expert-Reihe „Vermehrt auch bei Jüngeren – Nehmen Sie diese Darmkrebs-Alarmzeichen ernst“ auf seinen online-Plattformen. Prof. Dr. J.F. Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung LebensBlicke, berichtet in diesem Artikel über die zunehmende Zahl an Erkrankungen bei jüngeren Patienten, was man dagegen tun kann, und klärt über wichtige Symptome, Prävention und die Notwendigkeit der Vorsorge auf, gemäß dem Motto der Stiftung „Vermeiden statt leiden!“.
Baumspende der Stiftung LebensBlicke gedeiht prächtig!
 Der amerikanische Tulpenbaum gedeiht prächtig! Er wurde im Jahr 2023 von der Stiftung LebensBlicke anlässlich ihres 25-Jährigem Bestehens gestiftet und im Zedtwitz Park der Stadt Ludwigshafen (Mundenheim) gepflanzt, Davon konnte sich der Vorstandsvorsitzende Prof. J.F. Riemann erst kürzlich persönlich überzeugen (Bild). Die Stiftung nimmt aus diesem Anlass auch an einer Prämierungsfeier für das Engagement für mehr Grün in LU teil, die der Grüne Kreis e.V. Ludwigshafen am 13.9. im Wilhelm-Hack-Museum organisiert. Die Stiftung sieht diese Spende als ihren kleinen Anteil am Klimaschutz und an der Identifikation mit der Stadt ihrer Gründung an. Sie dankt dem Grünen Kreis der Stadt und der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck für diese Möglichkeit. Eine Plakette, die auf die Stiftung als Spender hinweist, wird folgen, sobald der Baumstamm kräftiger ist.
Der amerikanische Tulpenbaum gedeiht prächtig! Er wurde im Jahr 2023 von der Stiftung LebensBlicke anlässlich ihres 25-Jährigem Bestehens gestiftet und im Zedtwitz Park der Stadt Ludwigshafen (Mundenheim) gepflanzt, Davon konnte sich der Vorstandsvorsitzende Prof. J.F. Riemann erst kürzlich persönlich überzeugen (Bild). Die Stiftung nimmt aus diesem Anlass auch an einer Prämierungsfeier für das Engagement für mehr Grün in LU teil, die der Grüne Kreis e.V. Ludwigshafen am 13.9. im Wilhelm-Hack-Museum organisiert. Die Stiftung sieht diese Spende als ihren kleinen Anteil am Klimaschutz und an der Identifikation mit der Stadt ihrer Gründung an. Sie dankt dem Grünen Kreis der Stadt und der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck für diese Möglichkeit. Eine Plakette, die auf die Stiftung als Spender hinweist, wird folgen, sobald der Baumstamm kräftiger ist.
Nächste Generation Stuhltest zur Darmkrebsvorsorge
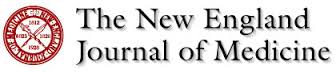 Ohne Frage ist die Koloskopie der Goldstandard zur Vorsorge des kolorektalen Karzinom. Die Alternative ist aktuell der immunologische Stuhltest (iFOBT), bei dem durch immunchemische Verfahren nicht sichtbares Blut im Stuhl nachgewiesen werden kann. Die Senstivität des iFOBT eine fortgeschrittene Läsion zu erkennen beträgt je nach verwendetem Test etwa 10-35% (Levy BT et al, Ann Intern Med 2024, doi: 10.7326/M24-0080). Damit kann zwar eine Vielzahl von Läsionen nachgewiesen werden, die Mehrzahl fortgeschrittener Läsionen wird jedoch nicht erkannt.
Ohne Frage ist die Koloskopie der Goldstandard zur Vorsorge des kolorektalen Karzinom. Die Alternative ist aktuell der immunologische Stuhltest (iFOBT), bei dem durch immunchemische Verfahren nicht sichtbares Blut im Stuhl nachgewiesen werden kann. Die Senstivität des iFOBT eine fortgeschrittene Läsion zu erkennen beträgt je nach verwendetem Test etwa 10-35% (Levy BT et al, Ann Intern Med 2024, doi: 10.7326/M24-0080). Damit kann zwar eine Vielzahl von Läsionen nachgewiesen werden, die Mehrzahl fortgeschrittener Läsionen wird jedoch nicht erkannt.
In der BLUE-C-Studie (Imperiale TF et al, NEJM 2024; 390: 984-993) haben Wissenschaftler einen neuen DNA-Test für Stuhlproben (next-generation multitarget stool DNA test) mit dem bekannten iFOBT-Test verglichen. Dazu wurden 20.176 Studienteilnehmer mit den Tests untersucht und die Ergebnisse mit der Koloskopie verglichen. Während mit dem iFOBT 23,3% der fortgeschrittenen Adenome erkannt werden konnten, wurde durch den neuen Test 43,4% erkannt. (Datei) Die Spezifität für negative Koloskopien war 92,7% für den neuen Test und 95,7% für den iFOBT.
„Die Studie zeigt, dass die Stuhltests zwar nicht an die Aussagekraft der Koloskopie heranreichen, dass aber zukünftige Entwicklungen Hoffnung auf eine Verbesserung der Krebsvorsorge machen können, insbesondere bei Personen, die keine Akzeptanz für die Darmspiegelung haben“, kommentiert Prof. Dr. Ch. Eisenbach für die Stiftung Lebensblicke.
Erweiterte Leitlinien für nicht-invasive KRK-Screening-Tests
 Schon im Jahre 2016 hat eine Expertenkommission eine praktische Leitlinie erstellt, wie neue, nicht-invasive Screening-Tests für die Vorsorge des Kolorektalen Karzinoms (KRK) evaluiert werden können. In den nächsten Jahren werden durch molekulare Diagnostik weitere Erkenntnisse für nicht-invasive Screening-Tests erwartet. Die Kommission formulierte damals acht Prinzipien. Diese wurden nun im vergangenen Jahr auf zwölf Prinzipien erweitert, die es Wissenschaftlern ermöglichen sollen, neue, nicht-invasive Technologien zu evaluieren. Dabei wird ein eindeutiges Ziel der Vorsorge, nämlich die Reduktion der Sterblichkeit am Kolorektalen Karzinom formuliert. Wichtige Outcome-Parameter in der Überprüfung neuer Methoden sind aber neben der Erkennungsrate der Vorstufen und der Karzinome auch die Teilnahmebereitschaft einer Screening-Population mit dem zu analysierenden Test. „Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der dann auch eine gute Grundlage sein kann, in einem politischen Prozess sich für verschiedene Tests im Screening zu entscheiden“, kommentiert Professor Dr. Dieter Schilling vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke (Bresalier RS et al. Gut 2023:72:1-15).
Schon im Jahre 2016 hat eine Expertenkommission eine praktische Leitlinie erstellt, wie neue, nicht-invasive Screening-Tests für die Vorsorge des Kolorektalen Karzinoms (KRK) evaluiert werden können. In den nächsten Jahren werden durch molekulare Diagnostik weitere Erkenntnisse für nicht-invasive Screening-Tests erwartet. Die Kommission formulierte damals acht Prinzipien. Diese wurden nun im vergangenen Jahr auf zwölf Prinzipien erweitert, die es Wissenschaftlern ermöglichen sollen, neue, nicht-invasive Technologien zu evaluieren. Dabei wird ein eindeutiges Ziel der Vorsorge, nämlich die Reduktion der Sterblichkeit am Kolorektalen Karzinom formuliert. Wichtige Outcome-Parameter in der Überprüfung neuer Methoden sind aber neben der Erkennungsrate der Vorstufen und der Karzinome auch die Teilnahmebereitschaft einer Screening-Population mit dem zu analysierenden Test. „Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der dann auch eine gute Grundlage sein kann, in einem politischen Prozess sich für verschiedene Tests im Screening zu entscheiden“, kommentiert Professor Dr. Dieter Schilling vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke (Bresalier RS et al. Gut 2023:72:1-15).
Darmkrebstherapie – neue begründete Hoffnungen
 Es gibt eine besondere Form des Darmkrebses, die ca. 85% der Tumore ausmacht, der sog. Mikrosatelliten-stabile Krebs. Darunter versteht man eine Eigenschaft der Zellen, nur begrenzt auf eine Immuntherapie zu reagieren. Das wäre aber wichtig, um das körpereigene Immunsystem zur Bekämpfung des Tumors zu aktivieren. Ein Forscherteam um Victoria Stary (Nature Communications 2024; 15: 6949) von der Medizinischen Universitätsklinik Wien hat nun die mögliche Ursache für das Therapieversagen identifiziert. Die Forscher fanden heraus, dass eine bestimmte Untergruppe der T-Zellen nicht ausreichend funktioniert, um den Krebs effektiv zu bekämpfen. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass man die Blockade aufheben kann, wenn ein bestimmtes Molekül auf den Zellen gehemmt wird. So können die wichtigen T-Zellen wieder besser gegen die Krebszellen ankämpfen. Fazit: Damit wurde ein weiterer Weg gefunden, die Behandlung der Darmkrebspatienten zu verbessern. Die neu gewonnenen Einblicke liefern eine mögliche Erklärung für das Therapieversagen und zeigen gleichzeitig vielversprechende therapeutische Optionen zur Behandlung des kolorektalen Karzinoms auf. Therapeutische Fortschritte beim Darmkrebs sind wichtig. Noch wichtiger ist allerdings die frühzeitige Darmkrebsvorsorge. Dafür steht die Stiftung Lebensblicke mit ihrem Vorsitzenden Prof. Dr. J. F. Riemann. Dr. H. Meyer – Stiftung Lebensblicke; Quelle: Medizin & Wissenschaft – Medizinische Universität Wien
Es gibt eine besondere Form des Darmkrebses, die ca. 85% der Tumore ausmacht, der sog. Mikrosatelliten-stabile Krebs. Darunter versteht man eine Eigenschaft der Zellen, nur begrenzt auf eine Immuntherapie zu reagieren. Das wäre aber wichtig, um das körpereigene Immunsystem zur Bekämpfung des Tumors zu aktivieren. Ein Forscherteam um Victoria Stary (Nature Communications 2024; 15: 6949) von der Medizinischen Universitätsklinik Wien hat nun die mögliche Ursache für das Therapieversagen identifiziert. Die Forscher fanden heraus, dass eine bestimmte Untergruppe der T-Zellen nicht ausreichend funktioniert, um den Krebs effektiv zu bekämpfen. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass man die Blockade aufheben kann, wenn ein bestimmtes Molekül auf den Zellen gehemmt wird. So können die wichtigen T-Zellen wieder besser gegen die Krebszellen ankämpfen. Fazit: Damit wurde ein weiterer Weg gefunden, die Behandlung der Darmkrebspatienten zu verbessern. Die neu gewonnenen Einblicke liefern eine mögliche Erklärung für das Therapieversagen und zeigen gleichzeitig vielversprechende therapeutische Optionen zur Behandlung des kolorektalen Karzinoms auf. Therapeutische Fortschritte beim Darmkrebs sind wichtig. Noch wichtiger ist allerdings die frühzeitige Darmkrebsvorsorge. Dafür steht die Stiftung Lebensblicke mit ihrem Vorsitzenden Prof. Dr. J. F. Riemann. Dr. H. Meyer – Stiftung Lebensblicke; Quelle: Medizin & Wissenschaft – Medizinische Universität Wien
ASS in der Prävention des KRK – wem könnte es nützen?
 Aspirin (ASS) wird seit langer Zeit als mögliches Medikament in der primären Prävention des Darmkrebses diskutiert. Bisher hat die deutsche S3-Leitlinie zum Kolorektalen Karzinom (KRK) unter Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen eine allgemeine Empfehlung zur Einnahme von ASS nicht gegeben. Auch in der Aktualisierung der Leitlinie 2024 wird ein solches positives Votum nicht vorgenommen. „Eine aktuelle große US-Studie, publiziert in JAMA Oncology (*), liefert Anhaltspunkte, wem eine präventive Gabe von ASS nützen könnte“, kommentiert Dr. Dietrich Hüppe vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke. Die Studie fasst unter Berücksichtigung von Lebestilfaktoren zwei Kohortenstudien zusammen: eine mit Frauen aus einer Studie von 121.700 Pflegerinnen, die ab 1967 beobachtet wurden und bei Studienbeginn zwischen 30 und 55 Jahre alt waren (Nurses’ Health Study, kurz NHS) und eine mit 51.529 Männern, die ab 1986 beobachtet wurden und zum Startzeitpunkt zwischen 40 und 75 Jahre alt waren (Health Professionals Follow-Up Study, kurz HPFS). Die Nachbeobachtungszeit ging bei beiden bis 2018. Die Teilnehmenden füllten alle zwei Jahre Fragebögen aus zu Ernährung, Lebensstil, Medikation, Erkrankungen und deren Verlauf inklusive KRK. Nach Aspirin-Einnahme wurde bei der NHS ab 1980 und der HPFS ab 1986 gefragt. Für die Analyse betrachteten die Autoren neben der Aspirin-Einnahme und Krebsinzidenz fünf verschiedenen Lebensstilfaktoren: den BMI, Rauchen, Alkoholkonsum, körperliche Aktivität und Ernährung. (Grafik: Strukturfomel ASS | Wikipedia) Weiterlesen
Aspirin (ASS) wird seit langer Zeit als mögliches Medikament in der primären Prävention des Darmkrebses diskutiert. Bisher hat die deutsche S3-Leitlinie zum Kolorektalen Karzinom (KRK) unter Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen eine allgemeine Empfehlung zur Einnahme von ASS nicht gegeben. Auch in der Aktualisierung der Leitlinie 2024 wird ein solches positives Votum nicht vorgenommen. „Eine aktuelle große US-Studie, publiziert in JAMA Oncology (*), liefert Anhaltspunkte, wem eine präventive Gabe von ASS nützen könnte“, kommentiert Dr. Dietrich Hüppe vom Vorstand der Stiftung LebensBlicke. Die Studie fasst unter Berücksichtigung von Lebestilfaktoren zwei Kohortenstudien zusammen: eine mit Frauen aus einer Studie von 121.700 Pflegerinnen, die ab 1967 beobachtet wurden und bei Studienbeginn zwischen 30 und 55 Jahre alt waren (Nurses’ Health Study, kurz NHS) und eine mit 51.529 Männern, die ab 1986 beobachtet wurden und zum Startzeitpunkt zwischen 40 und 75 Jahre alt waren (Health Professionals Follow-Up Study, kurz HPFS). Die Nachbeobachtungszeit ging bei beiden bis 2018. Die Teilnehmenden füllten alle zwei Jahre Fragebögen aus zu Ernährung, Lebensstil, Medikation, Erkrankungen und deren Verlauf inklusive KRK. Nach Aspirin-Einnahme wurde bei der NHS ab 1980 und der HPFS ab 1986 gefragt. Für die Analyse betrachteten die Autoren neben der Aspirin-Einnahme und Krebsinzidenz fünf verschiedenen Lebensstilfaktoren: den BMI, Rauchen, Alkoholkonsum, körperliche Aktivität und Ernährung. (Grafik: Strukturfomel ASS | Wikipedia) Weiterlesen
SLB beteiligt: 20 Jahre „Wattolümpiade“ endet mit Rekord
 Mit einem Weltrekord, einem riesigen Besucherandrang und einem stimmungsvollen musikalischen Ausklang ist in Brunsbüttel die jüngste Wattolümpiade zu Ende gegangen. Seit der ersten Wattolümpiade 2004 kamen unter dem Motto „Stark gegen Krebs“ mehr als 600.000 € für Krebshilfsprojekte an der schleswig-holsteinischen Westküste zusammen. Dr. Thomas Thomsen, Botschafter des Jahres der Stiftung LebensBlicke, war – wie auch kürzlich auf dem Wacken Open Air Festival – mit seinem Team vor Ort, um Gespräche mit Besucherinnen und Besucher zu führen und auf die wichtige Darmkrebsvorsorge aufmerksam zu machen. Und auch er trug seinen Teil zum Weltrekord bei, indem er sich in den Schlamm warf! Sein Körpereinsatz machte bei der letzten Wattolümpiade in Norddeutschland Furore und hat die Darmkrebsvorsorge in der öffentlichen Wahrnehmung ein großes Stück voran gebracht. (Foto: Peter Gürtler) Weiterlesen
Mit einem Weltrekord, einem riesigen Besucherandrang und einem stimmungsvollen musikalischen Ausklang ist in Brunsbüttel die jüngste Wattolümpiade zu Ende gegangen. Seit der ersten Wattolümpiade 2004 kamen unter dem Motto „Stark gegen Krebs“ mehr als 600.000 € für Krebshilfsprojekte an der schleswig-holsteinischen Westküste zusammen. Dr. Thomas Thomsen, Botschafter des Jahres der Stiftung LebensBlicke, war – wie auch kürzlich auf dem Wacken Open Air Festival – mit seinem Team vor Ort, um Gespräche mit Besucherinnen und Besucher zu führen und auf die wichtige Darmkrebsvorsorge aufmerksam zu machen. Und auch er trug seinen Teil zum Weltrekord bei, indem er sich in den Schlamm warf! Sein Körpereinsatz machte bei der letzten Wattolümpiade in Norddeutschland Furore und hat die Darmkrebsvorsorge in der öffentlichen Wahrnehmung ein großes Stück voran gebracht. (Foto: Peter Gürtler) Weiterlesen